Baustein der Träume
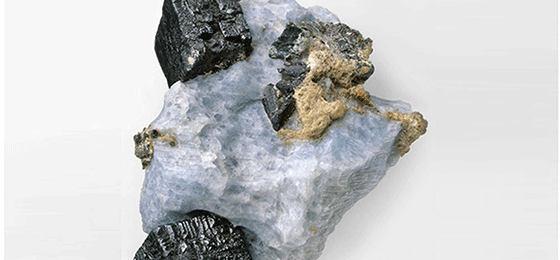
Nach dem Wirbel um Graphen folgt der um Perowskit. Die neue Materialklasse begeistert Forschung und Industrie gleichermassen. Von Fabien Goubet
(Aus "Horizonte" Nr. 107 Dezember 2015)Seit einigen Jahren stimmt eine zunehmende Zahl von Physikern, Chemikern und Ingenieuren ins Lob für ein Material ein, das den exotischen Namen Perowskit trägt. Perowskite sind Oxide und Gegenstand ebenso zahlreicher wie verheissungsvoller Forschungsprojekte, die von der Sonnenenergie über Laser bis zur Mikroelektronik reichen.
Die erste Erwähnung von Perowskit reicht ins Jahr 1839 zurück, als eine Gesteinsprobe aus Calcium-Titan-Oxid (CaTiO3) nach dem russischen Mineralogen Lew Perowski benannt wurde. Der Begriff wird seither für eine Klasse von Mineralien mit zwei Gruppen von oxidierten Atomen in derselben würfelähnlichen Kristallstruktur verwendet.
Massgeschneiderte Werkstoffe
Diese würfelähnliche Struktur ist weit verbreitet und "vermutlich die häufigste kristalline Form auf der Erde", präzisiert Jean-Marc Triscone, Physiker an der Universität Genf. "Aussergewöhnlich ist aber, dass bereits die kleinste Änderung bei den beteiligten Komponenten die Materialeigenschaften radikal verändert." So kann bei einem Perowskit ein Element durch ein anderes ersetzt werden, wodurch das Material beispielsweise seine magnetischen Eigenschaften zugunsten einer besseren Leitfähigkeit verliert. Es ist sogar möglich, unterschiedliche Perowskite zu kombinieren, um völlig neue, unerwartete Eigenschaften zu erzeugen. "Es ist wie bei Lego-Bausteinen: Verschiedene Perowskite lassen sich aufgrund ihrer identischen Kristallstruktur perfekt zu Systemen zusammenfügen, die über andere Eigenschaften als ihre Bestandteile verfügen."
Die Physiker verfolgen das etwas verrückte Ziel, massgeschneiderte Materialien herzustellen, die zu 100 Prozent die gewünschten Eigenschaften aufweisen. In Genf versucht Triscone, Perowskite zu einem Supraleiter zusammenzustellen, durch den Strom bei Zimmertemperatur ohne den geringsten Widerstand fliesst. Andere Physiker arbeiten an der Herstellung von Magneten mit supraleitenden Oxiden für den Teilchenbeschleuniger des Cern. Die Struktur dieser supraleitenden Oxide – für die Georg Bednorz und Alex Müller bei IBM Zürich 1987 den Nobelpreis für Physik erhielten – erinnert an eine Stapelung von Perowskiten.
Das ist nur ein Beispiel für eine Vielzahl möglicher Anwendungen, von der Entwicklung von Lasern über Leuchtdioden bis zu neuartigen digitalen Speichermedien. Ein weiteres vielversprechendes Gebiet: ferroelektrische Perowskite. Die aus Ionen bestehenden Kristalle weisen natürlicherweise eine elektrische Polarisation auf. Durch das Anlegen eines elektrischen Feldes wechselt die Ausrichtung der ferroelektrischen Bereiche, wodurch sich die Struktur geringfügig verändert, was wiederum andere thermische Eigenschaften zur Folge hat. Solche "intelligenten" Isolatoren könnten bedeutende Temperaturabweichungen aktiv korrigieren, wie sie durch Mikroprozessoren, Satellitenkomponenten oder Fahrzeugmotoren entstehen. "Allerdings wurde dieser Effekt erst bei sehr tiefen Temperaturen im Bereich von minus 190 Grad beobachtet", erklärt Christian Monachon, ein Schweizer Physiker an der Universität Berkeley in Kalifornien. Er ist aber zuversichtlich, dass sich diese Hürde überwinden lässt. "Meine Forschung deutet darauf hin, dass sich Materialien mit variablen thermischen Eigenschaften herstellen lassen, vielleicht auf der Grundlage von Bariumtitanat."
Der neue Sonnenkönig
Besonders grosse Hoffnungen ruhen auf den Perowskiten im Bereich der Solartechnik. In fünf Jahren konnte die Effizienz von Perowskit-Solarzellen vervierfacht werden. Bezüglich ihres Wirkungsgrads haben sie damit die Siliziumzellen beinahe erreicht und könnten diese vielleicht bald in den Schatten stellen.
Dieses Anwendungsgebiet zog die Aufmerksamkeit der Forschung nicht von Anfang an auf sich. "In den 1980er Jahren begann das Interesse an der Entwicklung von Laser-Anwendungen dieser Materialien", sagt der langjährige Kenner Jacky Even vom Nationalen Institut der angewandten Wissenschaften in Rennes (Frankreich). Die Begegnung zwischen Perowskiten und Sonne fand erst 2009 statt, als ein Team der Universität Toin in Yokohama versuchte, Perowskite in fotovoltaischen Zellen einzusetzen. "Das war angesichts der aussergewöhnlichen Eigenschaften dieser Mineralien eine gewagte Idee", fährt der Forscher fort. "Sie wollten die Lichtabsorption von Farbstoffsolarzellen verbessern, erzielten aber so klägliche Ergebnisse, dass dem Artikel vorerst niemand Beachtung schenkte."
Alles ändert sich, als sich 2012 zwei Fotovoltaik-Experten, Henry Snaith von der Universität Oxford und dessen früherer Mentor Michael Grätzel von der EPFL, unabhängig voneinander für dieses Material interessieren. Die beiden konkurrierenden Teams wenden sich vom Konzept jener Farbstoffsolarzellen ab, die von Grätzel in den 1990er Jahren entwickelt wurden. Stattdessen versuchen sie, eine neue Art von Solarzellen zu entwickeln, bei denen ein Perowskit, dessen Sauerstoffatome durch Iod- oder Bromatome ersetzt wurden, eine zentrale Rolle spielt.
Perowskit übernimmt dabei dieselbe Funktion wie Silizium in klassischen Solarzellen: Es absorbiert das Licht und transportiert gleichzeitig die elektrischen
Ladungen zwischen den Elektroden. Und wieder ist es die Modulierbarkeit des Materials, die diese Aufgabe ermöglicht. Ein Perowskit-Hybrid mit organischen und anorganischen Gruppen absorbiert zehnmal mehr Licht als Silizium und transportiert gleichzeitig die elektrischen Ladungen viel effizienter als die herkömmlichen Farbstoffe. "Das ist ein richtiger Entwicklungssprung, der zu einer neuen Richtung in der Fotovoltaik-Forschung geführt hat", fasst Jacky Even zusammen.
Konkurrenz für Silizium
Seither tobt ein Wettstreit zwischen den beiden Gruppen, zu denen inzwischen weitere gestossen sind. Ende September 2015 gab Michael Grätzel bei einem Kongress in Lausanne bekannt, dass ein Wirkungsgrad von 20,8 Prozent erreicht wurde, gegenüber 25,6 Prozent bei den besten Siliziumzellen, die immerhin seit über fünfzig Jahren weiterentwickelt werden. "Das ist ein ambitionierter Wettbewerb", bestätigt Joël Teuscher, Forscher der Photochemical Dynamics Group bei der EPFL. "Aber er ist auch gesund."
Heute nähert sich dieser Wettlauf um den höchsten Wirkungsgrad vermutlich der Zielgeraden. Es warten aber noch fundamentale Fragen auf die Wissenschaft. "Noch immer versuchen wir, die genauen Vorgänge zu verstehen", räumt Teuscher ein. "Wir erleben aber gerade eine aufregende Phase, in der die Arbeiten interdisziplinär werden." Die Antworten werden der Forschung helfen, die mit diesen Materialien verbundenen Hürden zu überwinden, wie die Instabilität – sie sind empfindlich und löslich – oder das Blei, das in diesen Kristallen enthalten ist und die Vermarktung
erschweren würde. Diese Bedenken relativiert Jacky Even allerdings: "Eine
Autobatterie enthält acht Kilogramm Blei, ein Quadratmeter Solarmodul gerade einmal ein halbes Gramm!"
Auch wenn Perowskit die Wissenschaft zum Träumen bringt, werden nicht alle Anwendungen erfolgreich sein. Jeder Vorteil wirft ebenso viele Probleme auf. "Perowskite eröffnen faszinierende Möglichkeiten", meint Jean-Marc Triscone. "Und auch wenn viele Forschungsbemühungen im Sand verlaufen, reicht vielleicht der Erfolg eines einzigen Projekts aus, um die Physik zu revolutionieren."
Fabien Goubet ist Wissenschaftsjournalist und schreibt für Le Temps.